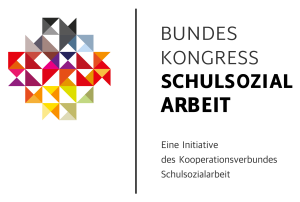Professionalität in der Schulsozialarbeit – zwischen Multiprofessionalität und Fachkräftemangel
Schulsozialarbeit ist in den letzten Jahrzehnten zu einem bedeutenden Handlungsfeld der Sozialen Arbeit herangewachsen. Dabei firmieren unter dieser Bezeichnung sowohl sozialpädagogische Angebote am Ort Schule als auch fest installierte Anlaufstellen für Kinder und Jugendliche, deren sozialpädagogischen Fachkräfte Schule als Bildungs- und Lebensort mitgestallten und mitformen. Gleichzeitig hat sich die Bandbreite von Bezeichnungen für die Angebote innerhalb dieses Handlungsfeld weiter ausdifferenziert und vervielfacht, was mit Fragen der Finanzierung und politischen Steuerung zusammenhängt. In den 2010er Jahren hatte sich ein fachpolitischer und wissenschaftlicher Diskurs herausgebildet, der die Ausformulierung von Grundprinzipien, Standards und Handlungsempfehlungen begünstigte und dadurch einen wichtigen Beitrag zum professionellen Handeln in der Schulsozialarbeit leistete. Dieser Diskurs unterstützte auch die zunehmende Verbreitung und Verwendung der Bezeichnung „Schulsozialarbeit“ unabhängig von den förderprogrammspezifischen Prägungen oder bundeslandspezifischen Traditionen. Im Jahr 2021 wurde der Begriff der Schulsozialarbeit bei der Reform des SGB VIII in §13a aufgegriffen, wodurch erstmalig ein eigener Paragraf für die Schulsozialarbeit im Kinder- und Jugendhilfegesetz implementiert wurde.
Die stetige Zunahme an Personalstellen im Handlungsfeld und die föderalen Strukturen im Bildungsbereich stellen die erarbeiteten fachlichen Standards teilweise wieder in Frage. Dem in allen Bereichen der Sozialen Arbeit bestehende Fachkräftemangel wird durch die Erfindung neuer Berufsbezeichnungen entgegengewirkt, denn letztere orientieren sich an den namensgebenden Förderprogrammen und verzichten zum Teil auf Qualifikationsanforderungen, wie sie im Fachkräftegebot ihren Ausdruck finden. Die in vielen fachlichen Publikationen zur Schulsozialarbeit geforderten multiprofessionellen Teams finden inzwischen ebenfalls Eingang in die Förderprogramme, bergen unter diesen neuen Rahmenbedingungen jedoch ebenfalls die Gefahr der De-Professionalisierung, da sie es ermöglichen, Fachkräfte sehr unterschiedlicher Qualifikation einzustellen.
Für die Vorträge, Workshops, Praxisbeispiele, Poster und andere Angebote in diesem Themenfeld ergeben sich die folgende Leitfragen:
- Was kennzeichnet professionelles Handeln in der Schulsozialarbeit?
- Wie kann man De-Professionalisierungsprozessen entgegenwirken?
- Wie kann die Schulsozialarbeit angesichts des Fachkräftemangels handlungsfähig bleiben?
- Welche Professionen braucht ein multiprofessionelles Team an einer Schule, um Bildung, Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit für alle Kinder und Jugendlichen zu sichern?
Was kennzeichnet multiprofessionelle Zusammenarbeit und welche Rahmenbedingungen ermöglichen eine solche Zusammenarbeit?